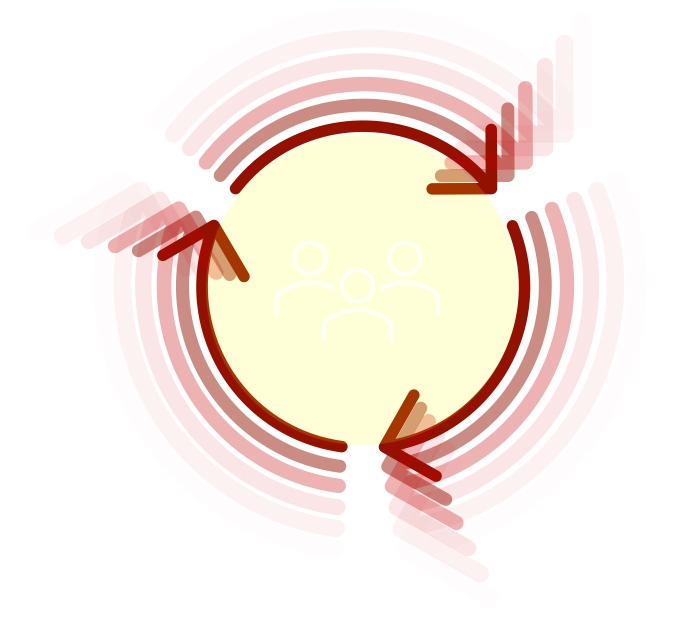Seit Menschen Gedenken finden Menschen zur Sorgearbeit für gemeinsame Ressourcen nachhaltig zusammen. Sie teilen, nutzen gemeinsam und bringen dauerhafte soziale Strukturen hervor, in denen sie kooperieren und Nützliches schaffen (= Commoning; Helfrich 2020, S.19). Das Gemeinsame gründet dabei auf wiederkehrenden Beziehungen und Handlungslogiken (= Mustern; Helfrich 2020, S.91), von denen für die Selbstorganisation von Gruppen und Gemeinschaften viel gelernt werden kann.
Elinor Ostrom hat aufgezeigt, dass die langfristige Nutzung von gemeinschaftlichen Ressourcen ohne zentrale Regulierung oder Privatisierung mittels Regulierung durch die Beteiligten selbst durchaus möglich ist. Ihren Erkenntnissen widmet sich mein Blog-Beitrag „Selbstorganisation der Nutzung von Gemeingütern“.
Silke Helfrich, David Bollier und die Heinrich-Böll-Stiftung eröffnen in mehreren Büchern die Welt der Commons, zuletzt arbeiteten sie unter der „Triade des Commoning“ (Helfrich, 2020) die gemeinsamen Essenzen erfolgreicher Problemlösungen in und durch Commons heraus, was getan wird, was gut funktioniert und es besser macht. Diese Muster entfalten ihre Kraft, wenn sie in der Praxis in ausreichender Dichte und Dauer angewendet werden, so die Schwelle bewusster Selbstorganisation erreichen und kohärente soziale Institutionen hervorbringen. Sie gliedern die destillierten Muster in drei miteinander verknüpfte Sphären, des Sozialen (soziales Miteinander), des Institutionellen (Selbstorganisation durch Gleichrangige) und des Ökonomischen (sorgendes & selbstbestimmtes Wirtschaften). (Helfrich, 2020, S.91ff).
Commons beschreibt komplexe, adaptive, lebendige Prozesse, in denen Vermögenswerte geschaffen und Bedürfnisse befriedigt werden. Dabei setzen die Beteiligten nur minimal oder gar nicht auf den Markt oder staatliche Institutionen. Ein Commons entsteht, wenn Menschen sich als Gleichrangige bewusst selbst organisieren und kooperative Formen entwickeln, Vermögenswerte bedürfnisorientiert schaffen und bereitstellen. Die Ergebnisse gehören keiner einzelnen Person allein; sie werden vielmehr geteilt, gemeinsam genutzt oder umgelegt. Commons sind stets im Werden. (Helfrich, 2020, S.72)
Folgend werden in der vielfältigen Praxis von Commons bewährte Muster - Muster des Sozialen Miteinanders, Muster der Selbstorganisation durch Gleichrangige - dargelegt (Helfrich, 2020, S.97-153), als Anhaltspunkte für Teams, Gruppen und Gemeinschaften, die sich zur nachhaltigen Erreichung eines gemeinsames Anliegens selbst organisieren wollen.
Inhaltsverzeichnis
ToggleMuster des Sozialen Miteinanders
- Gemeinsame Absichten & Werte kultivieren
Gemeinsame Absichten und Werte sind die Grundlage für den Zusammenhalt und die Lebendigkeit der Gemeinschaft. Sie entstehen, wenn Menschen aus eigenem Antrieb, aus Interesse und Leidenschaft heraus, etwas tun, was sie miteinander verbindet oder ihnen vergleichbare Erfahrungen ermöglicht. Absichten und Werte formal festzulegen, zu verkünden oder zu beschwören reicht jedoch nicht, sie müssen im Laufe der Zeit im gemeinsamen Tun erarbeitet und durch gemeinsame Reflexion, durch gelebte Traditionen, Feiern und sonstige Aktivitäten kultiviert werden. - Rituale des Miteinanders etablieren
Eine der wichtigsten Formen gemeinsame Absichten und Werte zu kultivieren und so eine identitätsstiftende Kultur des gemeinsamen Wirkens aufzubauen ist Rituale des Miteinanders zu etablieren und zu pflegen: regelmäßig zusammenkommen, sich vertieft miteinander austauschen, zB gemeinsam kochen, Erfolge feiern, Fehlschläge offen und ehrlich analysieren. - Ohne Zwänge beitragen
Ohne Zwänge beitragen bedeutet Geben ohne die Erwartung, etwas Gleichwertiges hier und jetzt zurückzubekommen. Es bedeutet auch, dass Mitglieder der Gemeinschaft nicht den Zwang empfinden, eine direkte und unmittelbare Gegenleistung erbringen zu müssen, sobald sie etwas bekommen. Die Gemeinschaft lebt von einem Kreislauf des Gebens und Nehmens in und aus ihr heraus. - Gegenseitigkeit behutsam ausüben
In der Gemeinschaft muss sichergestellt sein, dass Geben und Nehmen im Laufe der Zeit in einem grob ausgewogenen Verhältnis stehen, ohne auf eine zu prüfende strikte Gegenseitigkeit zu bestehen und ohne Beiträge zu erzwingen. Es kommt auf das Gefühl der Fairness an; alle Bedürfnisse werden aufgenommen und auch strukturell benachteiligte Personen erhalten in würdevoller Weise von ihnen Benötigtes. - Situiertem Wissen vertrauen
Ausgehend von der Erfahrung, dass ein großer Teil unseres Wissen unaussprechbar ist, in unserem Körper eingeschrieben ist, sich über Intuition äußert, ist es in der Gemeinschaft wichtig, nicht nur das „objektive“ Wissen gelten zu lassen. Das „subjektive“ Wissen, örtlich und sozial geprägt, erhält Raum, das Innenleben der Mitglieder der Gemeinschaft wird angesprochen und ernst genommen. - Naturverbunden sein vertiefen
Ein sorgender Umgang mit uns und mit dem, was uns trägt und umgibt, erfordert ein vertieftes Verbundensein damit. - Konflikte beziehungswahrend bearbeiten
Konflikte sind unvermeidlich - für das Gedeihen der Gemeinschaft ist entscheidend, wie damit umgegangen wird. Konflikte oder Regelverstöße sind offen und ehrlich zu thematisieren; mit einer Haltung des Respekts und des Sorgetragens für alle Beteiligten. Im beziehungswahrenden Umgang mit Konflikten ist zunächst zu beachten, den Schaden anzuerkennen und ihn dann – sofern möglich – zu beheben, wobei die Möglichkeiten und die Würde der Einzelnen nicht aus dem Blick geraten dürfen. Allen ist das Recht einzuräumen, gehört zu werden, Zeugnis abzulegen und Änderungen vorzuschlagen – und gleichzeitig über das wahrgenommene Problem und seine Wirkungen offen zu reden. Bewusstes Üben der beziehungswahrenden Konfliktlösung steigert die Fähigkeit der Gemeinschaft zum Umgang mit Dissens. - Eigene Governance reflektieren
Für die Gemeinschaft ist es unabdingbar, dass sie regelmäßig über die Art und Weise, wie sie sich und ihre Vorhaben steuert und organisiert, reflektiert. So werden Fehlentwicklungen erkannt und bearbeitet, durch Umweltveränderungen erforderlich gewordenen Adaptierungen bewusst und angegangen.
Grundlage für das soziale Miteinander in einem Commons ist das Grundverständnis des Ich-in-Bezogenheit. Das Selbst wird nicht als unteilbare, umgrenzte autonom handelnde Einheit verstanden, dem Gegenpol zum Wir, sondern innerhalb der vielen Beziehungen angenommen, die es formen und die ihm Sicherheit bieten. Das Verhältnis zwischen dem Ich und den Anderen beschreibt das Wort „Ubuntu“ aus der Bantu-Sprache: „Ich bin, weil wir sind, und weil wir sind, deshalb bin ich.“ (Helfrich, 2020, S.111)
Muster der Selbstorganisation durch Gleichrangige
- Sich in Vielfalt gemeinsam ausrichten
Ein Commons ist nicht einfach eine Gemeinschaft Gleichgesinnter, sondern ein soziales System, das sich durch viele Akte der Beziehungsaufbaus und der Diskussionen entwickelt. Am Anfang steht das gemeinsame Handeln, getragen vom Schub aus dem Alltag und aus der Vergangenheit, an den Erfahrungen und Motivationen der Beteiligten anknüpfend. Im gemeinsamen Tun, im Commoning, entsteht erst nach und nach eine gemeinsame Ausrichtung. Ein gemeinsamer Zweck kann herauskristallisiert und sollte geklärt werden, wenn das kollektive Handeln auf Dauer effektiv sein soll. Die gemeinsame Vision entfaltet und verwirklicht sich, durch geduldige Arbeit und den Respekt für die Individualität aller Beteiligten, die daraus eine Ethik des Gemeinsamen entwickeln können. Indem die Vielfalt an Beteiligten und Perspektiven akzeptiert wird, können verschiedenartige Störungen kompensiert, Widerstandskraft bewiesen werden. - Commons mit halbdurchlässigen Membranen umgeben
Commons benötigen klar definierte Grenzen, bezogen auf das bewirtschaftete Vermögen und die Nutzungsberechtigten. Zugleich müssen sie für Energieflüsse und Anregungen aus der Außenwelt offen sein, denn so erhalten sie sich. Indem die Grenzen gleich einer halbdurchlässigen Membran gestaltet werden, kann das Überleben und ein lebendiger Austausch mit der Umwelt gesichert werden. Was zuträglich ist, wird durchgelassen, was schaden könnte, herausgefiltert.
Eine schädliche Einwirkung wäre das Eindringen des Kommerzes, der Logik des Geldes, in die Steuerungsstrukturen des Commons (siehe Muster „Commons & Kommerz auseinanderhalten). - Im Vertrauensraum transparent sein
Transparenz erfordert Vertrauen, denn alles was offengelegt wird, kann und wird auch gegen einen selbst verwendet werden. Somit geht es bei Transparenz nicht nur um geeignete Strukturen und Verfahren, sondern vor allem darum, all das zu praktizieren, was Vertrauen stärkt und stiftet. Eine Umgebung, die Vertrauen ermöglicht, ist die einzige Möglichkeit, Menschen dazu zu bringen, verlässliche Informationen – auch unangenehme – einzubringen und gleichzeitig stabile Beziehungen aufrechtzuerhalten. - Wissen großzügig weitergeben
Gemeinschaften auf Augenhöhe müssen sicherstellen, dass Informationen und Wissen oft und großzügig weitergegeben werden und dass sie mit minimalem Widerstand durch das Netzwerk fließen können. Welche spezifischen Kreise Informationen und Wissen in der Gemeinschaft ziehen –Quellen, Austausch (meist verbreitet Meetings), Aufnahme und Einsatz (zB ist in Information der Impuls für weiteres Handeln enthalten), prägen ihre Sozialordnung. - Gemeinstimmig entscheiden
Für ein Commons ist es elementar, dass seine Mitglieder bei der Entwicklung der für sie geltenden Regeln tatsächlich mitreden können. Wesentlich ist, dass jeder Entscheidungsprozess die offene Diskussion fördert, alle sich ermutigt fühlen, ihre Sichtweisen einzubringen und sicher sind, dass auch tiefere Bedenken gehört werden.
Bei der Gestaltung des gemeinstimmigen Entscheidens sind zwei Unterscheidungen hilfreich: einmal, braucht es das volle Einverständnis aller, oder genügt, dass alle zustimmen, keinen Einwand haben und zum anderen, geht es nach gemeinsamen Kriterien oder ist eine Abstimmung der Gemeinschaft erforderlich. Gemeinstimmig entschieden ist auch dann, wenn Mitglieder entsprechend gemeinsam beschlossener Kriterien in Situationen ohne Abstimmung der Gemeinschaft entscheiden. - Auf Heterarchie bauen
Heterachien verbinden Organisationsformen auf Augenhöhe (horizontal) mit hierarchischen Strukturen (vertikal). Vertikal erlaubt auf mehreren Ebene zu agieren, horizontal ermöglicht den Einzelnen, sich in der Gemeinschaft ganz unterschiedlich zu positionieren, Potenziale verantwortungsbewusster Autonomie können sich entfalten. - Regeleinhaltung Commons-intern beobachten & stufenweise sanktionieren
Kein Commons kann langfristig bestehen, wenn nicht sichergestellt ist, dass die Beteiligten die Regeln befolgen, auf die sie sich geeinigt haben. Über Sanktionen wird „Trittbrettfahrerei“ und einseitiges Aufkündigen von Vereinbarungen verhindert. Dabei sind die Sanktionen abgestuft, zumeist wirkt bereits das Vorhandensein von Sanktionen. Sanktionen sind zunächst gering – etwa Warnung oder Aufforderung, das Verhalten zu ändern, sie verschärfen sich allmählich, wenn die Probleme nicht gelöst werden. Die abgestuften Sanktionen werden gemeinstimmig entschieden. - Beziehungshaftigkeit des Habens verankern
Das durch (Für-)sorge geprägte Vermögen eines Commons gehört nicht ausschließlich einer Person allein und auch nicht einer klar definierten Gruppe. Was zählt, sind Verfügungsmöglichkeit und Nutzung – und beides ist mit sozialen Beziehungen verknüpft, in Gegenwart als auch Vergangenheit und Zukunft. - Commons & Kommerz auseinanderhalten
Commons basieren nicht auf der Logik des Kommerzes, geldgestützter Kauf- und Verkaufstransaktionen. Commons können sich dem Kommerz nicht zur Gänze verschließen, müssen dessen Eindringen zwecks Überlebens verhindern.
Das betrifft einmal die Leistungsbeziehungen im Inneren. Die Einführung der Bezahlung lässt den sich freiwillig Engagierenden erscheinen, dass ihr Beitrag nicht mehr unabdingbar und weniger bedeutend ist; mit der Folge, dass sie weniger beitragen oder sich sogar zurückziehen.
Zum anderen führt die Ausrichtung des Commons auf entgeltlich Aufträge von außen zu einer Verschiebung der inneren Dynamik. Anstatt aus intrinsischen Gründen (Freude an der Aufgabe, Netzwerken, Lernen, Sozialleben, Sinnvolles tun) zu einem Projekt beizutragen, konzentriert sich die Aufmerksamkeit auf die Auftragserfüllung, getrieben von der Vereinnahmung des Entgelts. - Commons-Produktion finanzieren
Auch Commons müssen ihr Wirken finanzieren, allerdings hängt das Gelingen des Commoning davon ab, dass Geld nicht die sozialen Dynamiken bestimmt. Eine Möglichkeit die Herausforderung der Finanzierung zu verringern, wären die zu finanzierenden Notwendigkeiten zu reduzieren, indem das Commons seine eigenen Systeme, Infrastrukturen, Räume und Ressourcenpools zur gemeinsamen Nutzung selbst entwickelt. Eine andere Möglichkeit wäre die gemeinsame Finanzierung, so dass Geld und Kredite ausschließlich aus dem Commons heraus entstehen, darin zirkulieren und nicht zweckentfremdet werden. Eine dritte Möglichkeit wäre, dass die öffentliche Hand den Gemeinwohlbeitrag des Commons anerkennt und zur Finanzierung des Commons beiträgt.
Einordnung
Ein hilfreiches Werkzeug zum Setzen und Weiterentwickeln des Handlungsrahmens für ein Team ist der Leadership-Canvas. Diese „Leinwand“ visualisiert die IST-Situation der einzelnen thematischen Bausteine der Zusammenarbeit im Team (www.apiarista.de). Der Leadership-Canvas wird folgend bei der Einordnung der Muster des Commoning für die Ausgestaltung der Selbstorganisation einer Gemeinschaft genutzt.

Quellen
Helfrich Silke, Bollier David: Frei, fair und lebendig – Die Macht der Commons,
2. Auflage, Bielefeld 2020
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4530-9/frei-fair-und-lebendig-die-macht-der-commons/
Die Triade des Commoning
http://makecommoningwork.fed.wiki/view/die-triade-des-commoning/view/muster-des-sozialen-miteinanders/view/triade-des-commoning